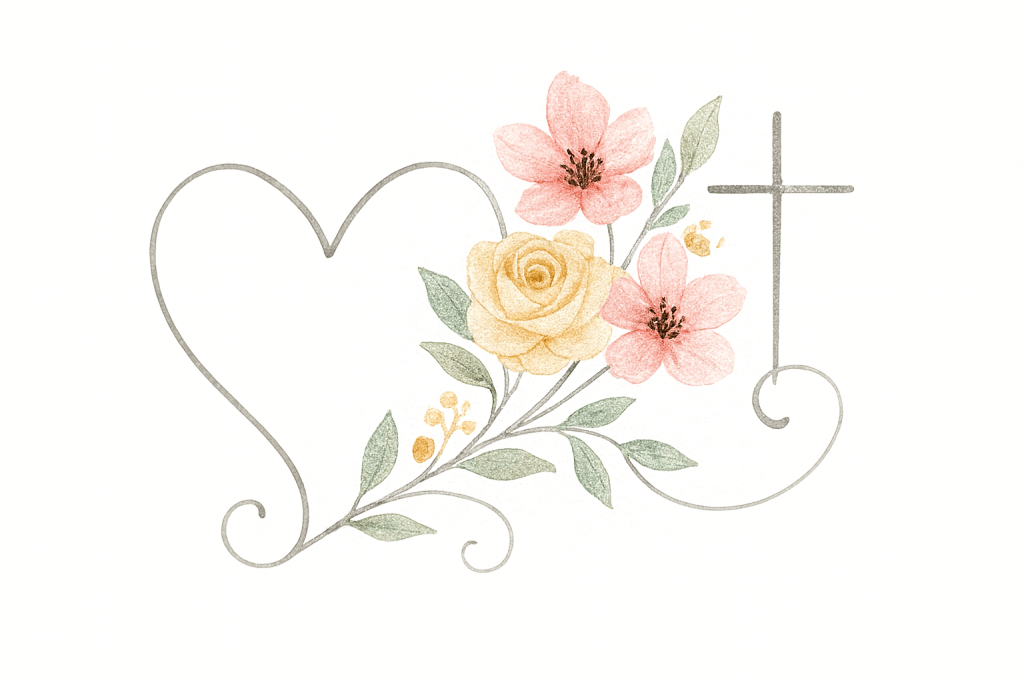Wie ich schon in meinem Vorstellungspost erwähnt habe, komme ich aus einem atheistischen Elternhaus. Wobei das nicht ganz richtig ist. Würde man meine Mutter und/oder meinen Vater fragen, ob es einen Gott gibt, dann würden sie diese Frage mit einem Ja beantworten. Erst wenn man dann weiterbohrt, wird klar, dass sie zwar an Gott und ein Leben nach dem Tod glauben, nicht jedoch an Jesus und daran, dass er eine Beziehung mit uns will und für unsere Sünden gestorben ist.
Ich weiß nicht, ob sie die Botschaft einfach nie so richtig gehört haben oder ob sie sie nicht annehmen wollen, aber es schmerzt mich zu wissen, dass mein Glaube – eines der wichtigsten Themen in meinem Leben – nicht zu den Dingen gehört, die mich mit meinen Eltern verbinden. Eher im Gegenteil.
Mein Weg zum Glauben, mein Leben im Glauben, aber vor allem die Veränderung, die ich durchlaufen habe – und immer noch durchlaufe – war und ist immer wieder (Streit-)Thema in unserer Beziehung.
Meine beste Freundin hat es einmal – in einer ganz schlimmen Phase – Verfolgung genannt. Damals wollte ich es abstreiten, doch konnte nicht. Denn wie definiert man Verfolgung? Im Internet heißt es: „Schikane von Menschen, die eine andere, zum Beispiel politische oder religiöse, Auffassung oder Lebensweise haben.“ Und das trifft zu. Wie oft war mein Glaube und die Veränderung, die er in mir bewirkt hat, Thema in einem Streit mit meiner Mutter? Wie oft hat sie mir deswegen gemeine Dinge an den Kopf geworfen? Versteht mich nicht falsch: Ich habe gelernt, meiner Mutter zu verzeihen – und habe ihr verziehen. Manchmal tut es trotzdem noch weh.
Kindheit
Hätte man mich vor fünf, zehn oder fünfzehn Jahren gefragt, ob ich an Gott glaube, hätte ich das bejaht. Hätte man gefragt, ob ich mein Leben mit Jesus lebe, hätte ich vermutlich geschwiegen.
Schon als Kind war ich neugierig. Meine Mutter meint, das habe wohl auch der evangelische Kindergarten geprägt, aber ich kann mich nicht daran erinnern – zumindest nicht an Tischgebete oder christlichen Input. Ich hatte ein Arche-Noah-Puzzle, ein Stapelspiel und irgendwann eine illustrierte Kinderbibel, die ich total gern gelesen habe. Wenn ich heute zurückblicke, war zwar die Neugier geweckt, aber verstanden habe ich es nie. Es waren einfach schöne Geschichten.
Einige Zeit war ich dann in der Jungschar, aber auch da waren es hauptsächlich schöne Geschichten. In die Kirche ging ich nur zu Weihnachten; an reguläre Gottesdienste kann ich mich nicht erinnern. Im Religionsunterricht war ich interessiert und wusste dank meiner Kinderbibel schon einiges über die biblischen Geschichten.
Mit neun wurde ich getauft – entschieden habe ich mich damals nicht bewusst dafür. Es war einfach „ein Schritt, den man eben macht“. Ich glaubte ja an Gott.
Jugend
Als wir umgezogen sind und ich eine neue Freundin fand, nahm sie mich irgendwann mit in die Kinderkirche. Ich war interessiert und neugierig, machte aber nie diesen entscheidenden Schritt zu Jesus. Mit 13 ließ ich mich konfirmieren. Im Konfi-Unterricht sah ich mich als eine der wenigen wirklich Gläubigen – also fiel es mir leicht, vor der Gemeinde „Ja“ zu sagen. Danach verlor ich jedoch die Lust an der Kirche, weil unser Pfarrer uns zum Gottesdienst zwang. Und aus Zwang mache ich grundsätzlich nichts gern.
Je älter ich wurde, desto schwieriger wurde die Beziehung zu meinen Eltern. Wir gerieten oft und stark aneinander. Mit etwa fünfzehn war ich an einem Punkt, an dem ich so niedergeschlagen war, dass ich Suizidgedanken entwickelte. Ich sah keinen Sinn mehr in dem Leben, das ich lebte. Versucht habe ich es nie, aber die Gedanken waren da.
Ich erinnere mich genau an einen Abend, an dem ich heulend und innerlich völlig zerbrochen auf meinem Bett saß und mir wünschte, dass mein Leben endet. Ich begann zu beten, zu flehen – zu einem Gott, von dem ich hoffte, dass er real war, dass er mich liebte und mich aus einem Grund erschaffen hatte. Dann machte ich ein Versprechen – an Gott und an mich selbst. Ich versprach, dass ich nicht aufgeben würde, bis ich mir meinen größten Traum erfüllt hätte: eine eigene Familie. In diesem Versprechen schwang die Hoffnung mit, dass ich, sobald ich das hätte, endlich glücklich wäre.
Die Beziehung zu meinen Eltern blieb eine Achterbahnfahrt – mit Hochs und Tiefs. Ich lief dreimal von Zuhause weg. Zweimal wurde ich zurückgeholt, einmal schaffte ich es bis zu meinem Opa, drei Stunden entfernt. Abends musste ich mein Handy abgeben, Nachrichten und Apps wurden manchmal kontrolliert. Ich verheimlichte Noten, versteckte Süßigkeiten, schmiss mein Pausenbrot weg. Ich war kein einfacher Teenager, und die Schuld an unserer schwierigen Beziehung lag nicht nur bei meinen Eltern. Ich hoffte einfach, dass alles besser würde, sobald ich achtzehn wäre.
Erste Berührungspunkte
Mit vierzehn wurde ich auf dem Straßenfest unseres Dorfes zu einem Jungscharcamp eingeladen. Meine Mutter meldete mich gemeinsam mit meinem Bruder an. Mit fünfzehn war ich wieder dabei. Dann kam Corona. Mit achtzehn, fast neunzehn, war ich schließlich Mitarbeiterin auf dem Camp. In demselben Sommer besuchte ich einen Freund, den ich durch das Camp und den Teenkreis kennengelernt hatte. Sowohl das Camp als auch der Teenkreis wurden von einer freikirchlichen Gemeinde organisiert. Dort fühlte ich mich viel wohler als in der „normalen“ Kirche. Die Gottesdienste waren freier, lebendiger, persönlicher. Während Corona kam ich nicht, aber die Neugier war geweckt.
Ausbildung
Ich bestand mein Abitur und begann mein FSJ im Kindergarten. Das tat der Beziehung zu meinen Eltern gut, doch durch das Pendeln entstanden neue Konflikte. Meine Mutter machte mir Druck, endlich zu wissen, „was aus mir werden soll“. Schließlich entschied ich mich für die Ausbildung zur Erzieherin – und bin bis heute zufrieden damit.
Mit neunzehn wurde vieles besser. Ich hatte mehr Freiheiten, keine Handyabgabe mehr. Nur Freunde hatte ich kaum. Im Mai verlor ich durch einen Streit meine damalige beste Freundin. Ich saß heulend im Auto – der seelische Schmerz war fast körperlich. Außerdem hatte ich einen Großteil meiner Jugend mit Corona verbracht und daher überhaupt keinen Bezug zum Ausgehen. Ein Abend mit einem guten Buch war mir lieber als jede Party. Ich war neugierig auf das Leben, aber hatte einfach keine Menschen, mit denen ich es teilen konnte.
Neuanfang und Entscheidung
Mit zwanzig begann ich meine Ausbildung. Zu diesem Zeitpunkt nahm mich meine heutige beste Freundin regelmäßig mit zu Jugendgottesdiensten und anderen Veranstaltungen. Wir hatten schon zu Schulzeiten festgestellt, dass wir in dieselbe Gemeinde gingen – nur an unterschiedlichen Orten. Ich lernte viele Jugendliche und junge Erwachsene kennen, die ihr Leben aktiv mit Jesus lebten. Zum ersten Mal sah ich junge Menschen, die Spaß hatten – ganz ohne Alkohol, ohne Party. Ich wusste, dass meine Freundin durch ihren Glauben aufblühte. Und ich wollte das auch: Gemeinschaft, Freude, Sinn. Ich verspürte eine Sehnsucht, konnte sie aber nicht erklären. Eigentlich fand ich viele christliche Regeln doof – kein Sex vor der Ehe, das Verurteilen von LGBTQ+ und andere Dinge. Dennoch merkte ich, wie ich mich danach sehnte, dazuzugehören.
Im November fand ein Fest unserer Berufsschule statt. Danach zogen einige von uns in eine Bar weiter. Wir tranken, tanzten, lachten. Ich ging nicht zu mir nach Hause, sondern begleitete einen Klassenkameraden – und am Ende führte eines zum anderen. Am nächsten Tag kassierte ich einen Korb: Es sei eine „einmalige Sache“ gewesen. Ich war verletzt, verwirrt und konnte mit niemandem darüber reden.
Ein Monat verging, dann stand der nächste Jugendgottesdienst an. Danach sprach ich endlich mit meiner besten Freundin. Ich hatte Angst vor ihrer Reaktion – doch sie reagierte mit Verständnis und Liebe. „Jesus liebt dich trotzdem, Lena.“
Und ich glaube, in dieser Zeit – nach diesem Erlebnis und diesem Gespräch – wurde mir klar, dass ich an einem Scheideweg stand. Ich hatte genug gehört und erlebt, um zu wissen: Gott will Beziehung mit mir.
All in – mein Ja zu Jesus
Die endgültige Entscheidung fiel irgendwann zwischen Pfingsten und Sommer. Über Pfingsten war ich mit meiner besten Freundin auf dem Pfingstjugendtreffen (PJT), einem christlichen Festival mit dutzenden Angeboten. Ich war überwältigt. Besonders ein Lied berührte mich tief: Es sprach davon, mutig Schritte im Glauben zu gehen, auch wenn man nicht sieht, wohin sie führen.
“…If faith requires actions / Even if it’s blind, I’m going / To every question / You are what I believe / So wherever You’re going, God, that’s where I wanna be / You dare me to move where I can’t see / Ready to do what used to scare me / Faith is a step into eternity / If you want Him, say you’re all in…”
Im Juli war dann ein Jugendwochenende unseres Verbunds: Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus den Gemeinden kamen zusammen. Die Predigten waren gut, lebendig, echt.
Bis Sonntag. Irgendetwas in der Session, in der Predigt, ging mir so tief unter die Haut, dass ich beim anschließenden Worship mit Tränen in den Augen aufstand und das Zelt verließ. Draußen suchte ich mir eine Bank, setzte mich, versuchte mich zu beruhigen. In meinem Kopf war nur Chaos.
Will ich das wirklich – von Gott angenommen werden? Ja! …aber zu welchem Preis?
Eine Ehrenamtliche kam zu mir, setzte sich neben mich. „Möchtest du reden?“, fragte sie sanft. Ich schüttelte den Kopf. Also blieb sie einfach sitzen. Schweigend. Nicht zu nah, nicht zu weit weg. Drinnen sangen die anderen weiter Lobpreis. Ich hörte die Musik, fühlte die Nähe, war irgendwie abwesend – und doch ganz da.
Und irgendwo zwischen PJT, diesem Wochenende und den Wochen danach traf ich meine Entscheidung: Ja zu Jesus. Mit allem, was dazugehört.
Im Sommer lernte ich eine junge Frau kennen, die ich heute ebenfalls als eine meiner besten Freundinnen ansehe. Sie nahm mich mit in ihre Gemeinde, und ich fühlte mich sofort wohl. Ab Herbst ging ich regelmäßig in ihren Jugendkreis, trat dem Jugend-Veranstaltungsteam bei und wurde Teil der Gemeinschaft.
Heute
Heute ist diese Gemeinde meine Gemeinde. Ich bin Teil des Musikteams und des Jugend-Veranstaltungsteams, habe Freunde gefunden und fühle mich angenommen wie nie zuvor.
Ich bin angekommen. Und glücklich.
Auch jetzt stolpere ich manchmal über meine Zweifel, aber ich weiß, dass Jesus mich auffängt. Ich bin dankbar, dass er mich nicht nur liebt, sondern ganz aktiv die Hand nach mir ausgestreckt hat – und ich jetzt mein Leben ganz bewusst mit ihm leben darf.